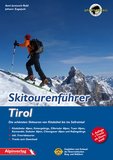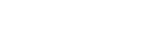Die sogenannte Grundlagenausdauer ist die Basis für alle Bergsport-Disziplinen und sie sollte nicht nur für den Aufstieg reichen, denn, oben angekommen, muss man schließlich auch wieder hinunter. Viele Klettersteige liegen in einer alpinen Umgebung und haben oft einen langen Zu- und Abstieg. Mit einer mangelnden Grundlagenausdauer kommt man bereits geschwächt beim Einstieg des Klettersteiges an und diese Schwäche begleitet einen dann durch den gesamten Klettersteig. Kommt man z.B. durch Wetterverschlechterung in eine Notsituation, ist es wichtig Reserven zu haben.
Probleme mit dem Kreislauf, Überlastung und Erschöpfung gelten als die häufigsten Unfallursachen in den Bergen, insbesondere bei älteren Menschen. Oft sind es die Überanstrengung am ersten Tourentag, zu schnelles Losgehen oder Erschöpfung in Verbindung mit besonderen Witterungsverhältnissen und mit mangelnder körperlicher Fitness.
Eine gute Grundlagenausdauer wirkt sich auch positiv auf die Kraftausdauer aus, die man in längeren Klettersteigen in den Armen braucht. Manche Klettersteig-Touren sind so lang, dass man sie ohne eine gute Grundlagenausdauer gar nicht bewältigen kann. Hinzu kommt noch, dass sich einige Steige auf einer beachtlichen Meereshöhe befinden, was bei Flachländlern ohne entsprechende Akklimatisation zu einer erhöhten Beanspruchung des Herz-Kreislaufsystems führt.
Eine gute Grundlagenausdauer gehört daher zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren beim Klettersteiggehen
Ausdauertraining
Die für das Bergsteigen und den Klettersteig so wichtige Grundlagenausdauer lässt sich eigentlich recht einfach trainieren. Grundsätzlich unterscheidet man zwei Grundlagenausdauerarten GLA1 und GLA2. Bei der GLA1 bewegt man sich (Laufen, Radfahren, Bergwandern, Bergsteigen oder zur Not auch das Laufband) mit besonders niedriger Intensität (= Belastung): 60-75% der maximalen Pulsfrequenz oder einfach zu messen, dass man während der Anstrengung noch ganz gemütlich, ohne nach Luft zu schnappen, plaudern kann – lächeln statt hecheln!. Die Bewegung findet nach der Dauermethode möglichst konstant statt, also nicht schnell starten und bald eine Verschnaufpause einlegen.
Trainingsbeispiel GLA1
- Pulsfrequenz: 60 bis 75%
- Trainingsdauer: 30 (Anfänger) - 90 (Fortgeschrittene) Minuten
- Trainingsmethode: Dauermethode (d.h. z.B. Dauerlauf ohne Intervalle)
- Wochenumfang: 1 bis 4-mal, je nach Trainingsaufwand und -ziel.
- Regeneration: bis zu 1 Tag.
Vom Stoffwechsel her ist man im sogenannten aeroben Bereich, das heißt, dem Körper steht dafür immer genug Sauerstoff zur Verfügung und er verbrennt primär Fette, was auch positiv beim Abnehmen helfen kann. Im Muskel wird kaum Laktat gebildet und es kommt nicht zur Übersäuerung und Krämpfen.
Bei einer langen Klettersteig-Tagestour sollte man im GLA1 Bereich mit niedriger Intensität bleiben, wobei durch den Zu- und Abstieg primär die Beinmuskulatur lange belastet wird.
Im GLA2 Bereich ist die Intensität schon etwas höher, 75 – 85% der maximalen Herzfrequenz. Die Mustkulatur holt sich seine Energie aus Glykose/Kohlehydraten und es fällt Laktat an. Der Körper lernt aber, mit diesem Laktat umzugehen, die Laktattoleranz nimmt zu und man kann auch längere Zeit höhere Geschwindigkeiten am Berg gehen.
Anfänger trainieren aufgrund ihrer falschen Eigeneinschätzung gefühlsmäßig oft in diesem Bereich und können innerhalb kurzer Zeit zwar ihre persönliche Leistung verbessern – landen aber bald darauf auf einem Formplateau.
Besser ist ein Grundlagentraining im GA1-Bereich über langsame und lockere Läufe, später über Longjogs. Dadurch wird das Transportsystem für den Sauerstoff (Herz-Kreislaufsystem) stark verbessert. Natürlich könnt ihr auch mit einem eigenen Trainingsplan laufen. Die häufigsten Fragen zu einem Trainingsplan werden beispielsweise von SportScheck beantwortet.
Trainingsbeispiel GLA2
- Pulsfrequenz: 75 bis 85%, flott, aber nicht am Anschlag
- Trainingsdauer: 20 (Anfänger) - 60 (Fortgeschrittene) Minuten
- Trainingsmethode: Dauerlauf mit wahlweise Intervallen (kurze Tempozunahme)
- Wochenumfang: 1 bis 3-mal, je nach Trainingsaufwand und -ziel.
- Regeneration: 1 -2 Tage.
Auf einer langen Klettersteigtour mit 2-3 Stunden Zustieg sollte man unbedingt langsam starten und den gesamten Zustieg möglichst gemütlich in der GLA1 Intensität absolvieren, denn der eigentliche Teil der Tour, den man nicht erschöpft meistern will, beginnt erst am Einstieg des Klettersteiges.
Beim Königsjodler Klettersteig hat man eine Gesamt-Bewegungsdauer von über 10 Stunden. Diese kann man nur in einer niedrigen Intensität durchhalten. Je schwerer allerdings die Kletterpassagen in einem Steig sind, desto mehr verteilt sich die Belastung von den Beinen auf die Arme.
In den Bergen braucht man auch unbedingt eine körperliche Reserve für unvorhergesehene Notfälle (Wetterumschwung, der mich zum schnellen Abstieg zwingt, oder Unfall).
Bei den immer häufiger vorzufindenden talnahen Sportklettersteigen wie z.B. den Klettersteig-Garten-Weichtalhaus mit Zustiegen unter 30 Minuten und hohen Schwierigkeiten am Steig verliert die Grundlagenausdauer deutlich an Bedeutung. Kraft und Technik treten an ihre Stelle.
Autor: Andreas Jentzsch, Staatlich geprüfter Sportklettertrainer

 Beim längsten Klettersteig der Schweiz am Daubenhorn ist die Ausdauer ein Überlebensfaktor
Beim längsten Klettersteig der Schweiz am Daubenhorn ist die Ausdauer ein Überlebensfaktor